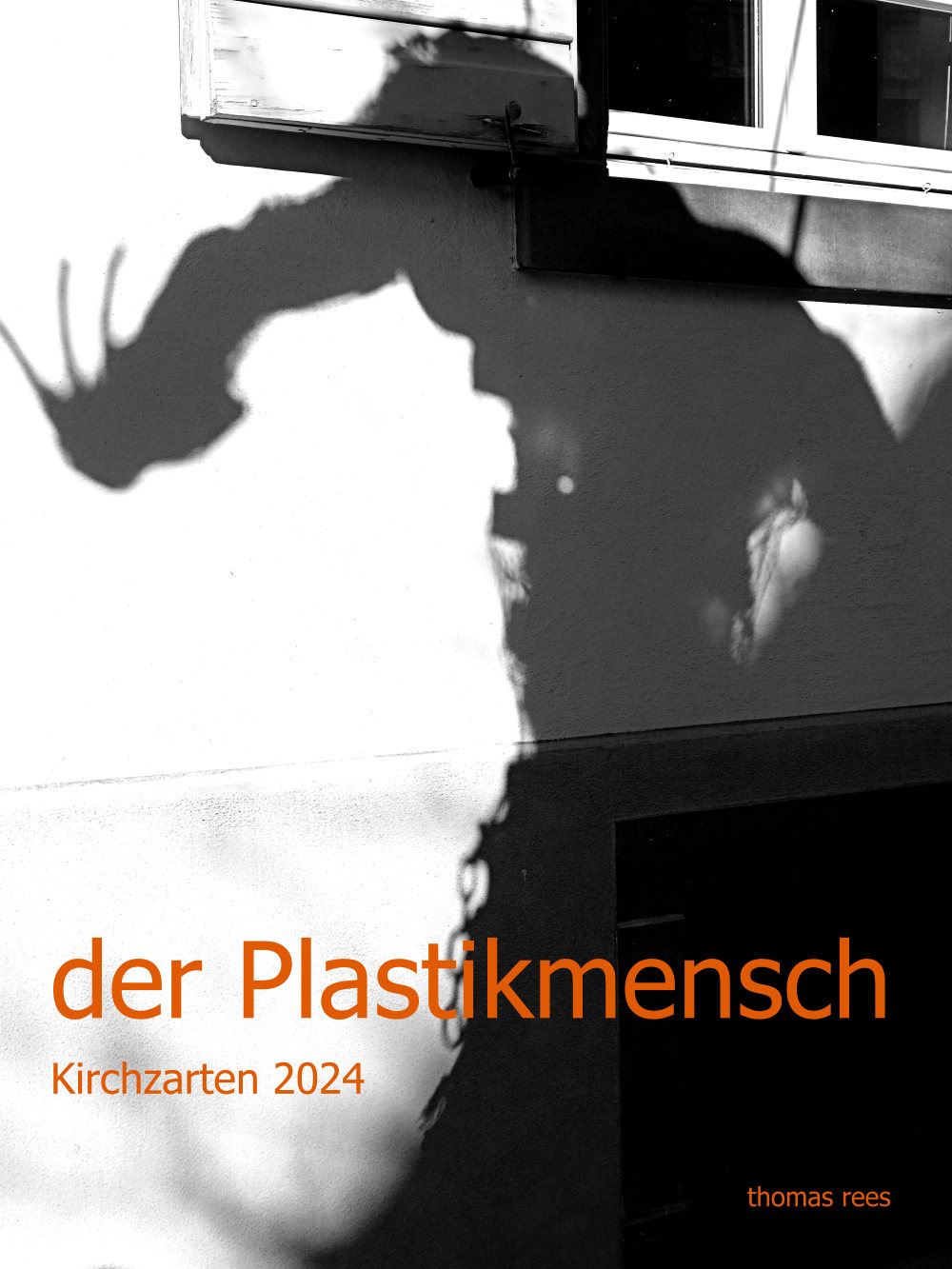Was Mäuseschwänzchen mit Douglasienzapfen zu tun haben: Klaus Gülker erzählt es Ihnen.
 Das Kappler Tal gehört naturräumlich bereits zum Südschwarzwald, an dessen steil aufsteigender Westflanke die zum Rhein hin entwässernden Bäche und Flüsse tiefe Kerbtäler und Schluchten erodiert haben. Über die steilen Hängen haben sich nacheiszeitlich mächtige Lagen aus Gesteinsschutt gelagert, über denen sich tiefgründige und relativ nährstoffreiche Braunerde-Böden entwickeln konnten. Der natürliche Wald ist von Rot-Buchen dominiert, zu der v.a. auf Südhängen bis etwa 600m ü.d.M. die Trauben-Eiche beigemischt ist. Zwischen 600 und 900 m ü.d.M. wird dann die Weiss-Tanne immer häufiger und bildet gemeinsam mit der Buche die für diese Gebiete typischen Buchen-Tannen-Wälder. Die Fichte, auch Rot-Tanne genannt und auf dem Etikett des „Tannezäpfle“-Biers dargestellt, spielt von Natur aus erst in den allerhöchsten Lagen des Schwarzwaldes eine Rolle.
Das Kappler Tal gehört naturräumlich bereits zum Südschwarzwald, an dessen steil aufsteigender Westflanke die zum Rhein hin entwässernden Bäche und Flüsse tiefe Kerbtäler und Schluchten erodiert haben. Über die steilen Hängen haben sich nacheiszeitlich mächtige Lagen aus Gesteinsschutt gelagert, über denen sich tiefgründige und relativ nährstoffreiche Braunerde-Böden entwickeln konnten. Der natürliche Wald ist von Rot-Buchen dominiert, zu der v.a. auf Südhängen bis etwa 600m ü.d.M. die Trauben-Eiche beigemischt ist. Zwischen 600 und 900 m ü.d.M. wird dann die Weiss-Tanne immer häufiger und bildet gemeinsam mit der Buche die für diese Gebiete typischen Buchen-Tannen-Wälder. Die Fichte, auch Rot-Tanne genannt und auf dem Etikett des „Tannezäpfle“-Biers dargestellt, spielt von Natur aus erst in den allerhöchsten Lagen des Schwarzwaldes eine Rolle.
Von dieser typischen Abfolge der Baumartenzusammensetzung kann man auch auffällige Abweichungen erkennen. An flachgründigen Stellen, an denen über dem anstehenden Gneis sich nur ein schwach entwickelter Ranker-Boden befindet, wird die Wald-Kiefer dominant, in unteren Lagen noch gemeinsam mit der Eiche, ansonsten oft mit der Hänge-Birke und Vogelbeere. In den feuchten, oft auch schattig-kühlen Einkerbungen der Seitenbäche findet man Eschen und Berg-Ahorn auf feinerdereichen Böden, an Bachläufen auch Schwarzerlen. Im Frühling fällt durch die weiße Blütenpracht die beigemischte Wild-Kirsche auf.
 Dieses natürliche Waldbild ist im Laufe der Jahrhunderte sehr stark durch die Bewirtschaftung verändert worden. Durch die intensive Nutzung in früheren Zeiten für Bau- und Brennholz, für Gerätschaften, für die Holzkohleherstellung (vgl. POI Köhlerei) aber auch als Viehweide und besonders hier in Kappel auch für Grubenholz im Bergbau wurde der Wald stark dezimiert. Erst die Entwicklung des Forstwesens und des Konzeptes der Nachhaltigkeit im 18. Jhd. – welches in seiner ursprünglichen Bedeutung besagt, dass nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils wieder nachwächst –, die badischen Forstgesetze von 1833 und 1840, sowie die Gründung des ersten forstlichen Lehrstuhls an der Universität Freiburg im Jahr 1787, schufen die Vorraussetzung für eine geregelte Waldwirtschaft in der Region. Wichtigstes Ziel war es zunächst, die verlorengegangene Waldfläche rasch aufzuforsten, wofür sich die Fichte als schnellwachsende Baumart bestens eignete. An dieser Baumart wurde dann auch lange Zeit festgehalten, weshalb heute die Wälder im Kappler Tal zum großen Teil von der Fichte dominiert werden. Auch die aus Nordamerika stammende Douglasie wurde forstlich eingebracht und man kann sie durch ihr blaugrünliches Nadelkleid auch von Weitem gut erkennen. Vereinzelt findet man auch die aus dem Alpenraum hier her gebrachte Lärche, die im Winter ihre Nadeln abwirft.
Dieses natürliche Waldbild ist im Laufe der Jahrhunderte sehr stark durch die Bewirtschaftung verändert worden. Durch die intensive Nutzung in früheren Zeiten für Bau- und Brennholz, für Gerätschaften, für die Holzkohleherstellung (vgl. POI Köhlerei) aber auch als Viehweide und besonders hier in Kappel auch für Grubenholz im Bergbau wurde der Wald stark dezimiert. Erst die Entwicklung des Forstwesens und des Konzeptes der Nachhaltigkeit im 18. Jhd. – welches in seiner ursprünglichen Bedeutung besagt, dass nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils wieder nachwächst –, die badischen Forstgesetze von 1833 und 1840, sowie die Gründung des ersten forstlichen Lehrstuhls an der Universität Freiburg im Jahr 1787, schufen die Vorraussetzung für eine geregelte Waldwirtschaft in der Region. Wichtigstes Ziel war es zunächst, die verlorengegangene Waldfläche rasch aufzuforsten, wofür sich die Fichte als schnellwachsende Baumart bestens eignete. An dieser Baumart wurde dann auch lange Zeit festgehalten, weshalb heute die Wälder im Kappler Tal zum großen Teil von der Fichte dominiert werden. Auch die aus Nordamerika stammende Douglasie wurde forstlich eingebracht und man kann sie durch ihr blaugrünliches Nadelkleid auch von Weitem gut erkennen. Vereinzelt findet man auch die aus dem Alpenraum hier her gebrachte Lärche, die im Winter ihre Nadeln abwirft.
 Heute wird ein stabiler Mischwald aus Laub- und Nadelhölzern angestrebt, der in Einzelbaumnutzung oder kleineren Hieben nachhaltig genutzt wird. Starke Stürme und Orkane können immer wieder Windwurflücken in die Bestände reissen, teilweise auch auf größerer Fläche. Neue Gefahren drohen dem Wald heute v.a. durch andauernden, atmosphärischen Stickstoffeintrag aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und aus landwirtschaftlichen Emissionen, der nach wie vor die Böden versauert und überdüngt.
Heute wird ein stabiler Mischwald aus Laub- und Nadelhölzern angestrebt, der in Einzelbaumnutzung oder kleineren Hieben nachhaltig genutzt wird. Starke Stürme und Orkane können immer wieder Windwurflücken in die Bestände reissen, teilweise auch auf größerer Fläche. Neue Gefahren drohen dem Wald heute v.a. durch andauernden, atmosphärischen Stickstoffeintrag aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und aus landwirtschaftlichen Emissionen, der nach wie vor die Böden versauert und überdüngt.
 Aktuell stehen die Folgen der menschengemachten Klimaerwärmung im Brennpunkt: zunehmende Trockenheit und sommerliche Dürre, zuletzt in den Jahren 2003, 2018 und 2019 setzen v.a. der Fichte, aber auch der Tanne sichtlich zu. Sie verlieren Nadeln, aber auch ihre Widerstandskraft gegen den Borkenkäfer, was den Baum letztlich zum Absterben bringt. So wird sich auch das zukünftige Waldbild vom heutigen unterscheiden: vermutlich wird die Fichte in den tieferen und mittleren Lagen verschwinden, Buche und Tanne sich zugunsten der Eiche und Douglasie in höhere Lagen zurückziehen.
Aktuell stehen die Folgen der menschengemachten Klimaerwärmung im Brennpunkt: zunehmende Trockenheit und sommerliche Dürre, zuletzt in den Jahren 2003, 2018 und 2019 setzen v.a. der Fichte, aber auch der Tanne sichtlich zu. Sie verlieren Nadeln, aber auch ihre Widerstandskraft gegen den Borkenkäfer, was den Baum letztlich zum Absterben bringt. So wird sich auch das zukünftige Waldbild vom heutigen unterscheiden: vermutlich wird die Fichte in den tieferen und mittleren Lagen verschwinden, Buche und Tanne sich zugunsten der Eiche und Douglasie in höhere Lagen zurückziehen.
Prof. Dr. Michael Scherer-Lorenzen
Quellen: Reif, A. & Hetzel, G. (1994) Die Vegetation der Waldaußenränder des Großen Kappler Tales bei Freiburg, Südschwarzwald. Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 16: 1-34 Wilmanns, O. (2001) Exkursionsführer Schwarzwald. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. Konold, W. & Seitz, B.-J. (2018) Biosphärengebiet Schwarzwald.Silberburg Verlag, Tübingen.