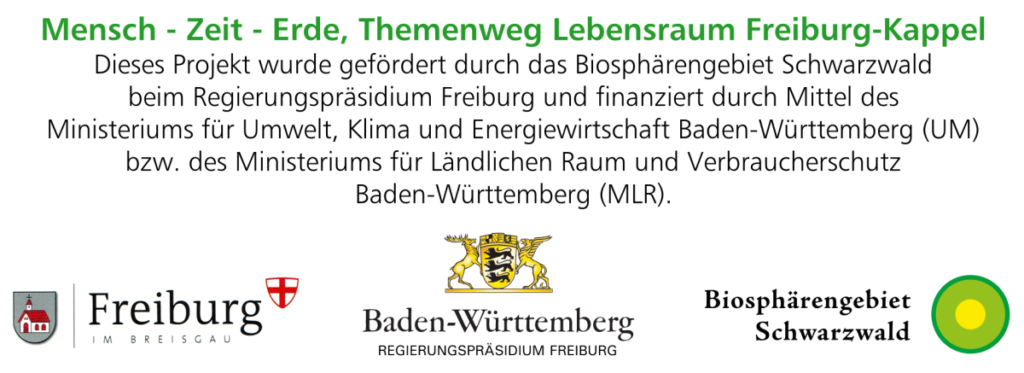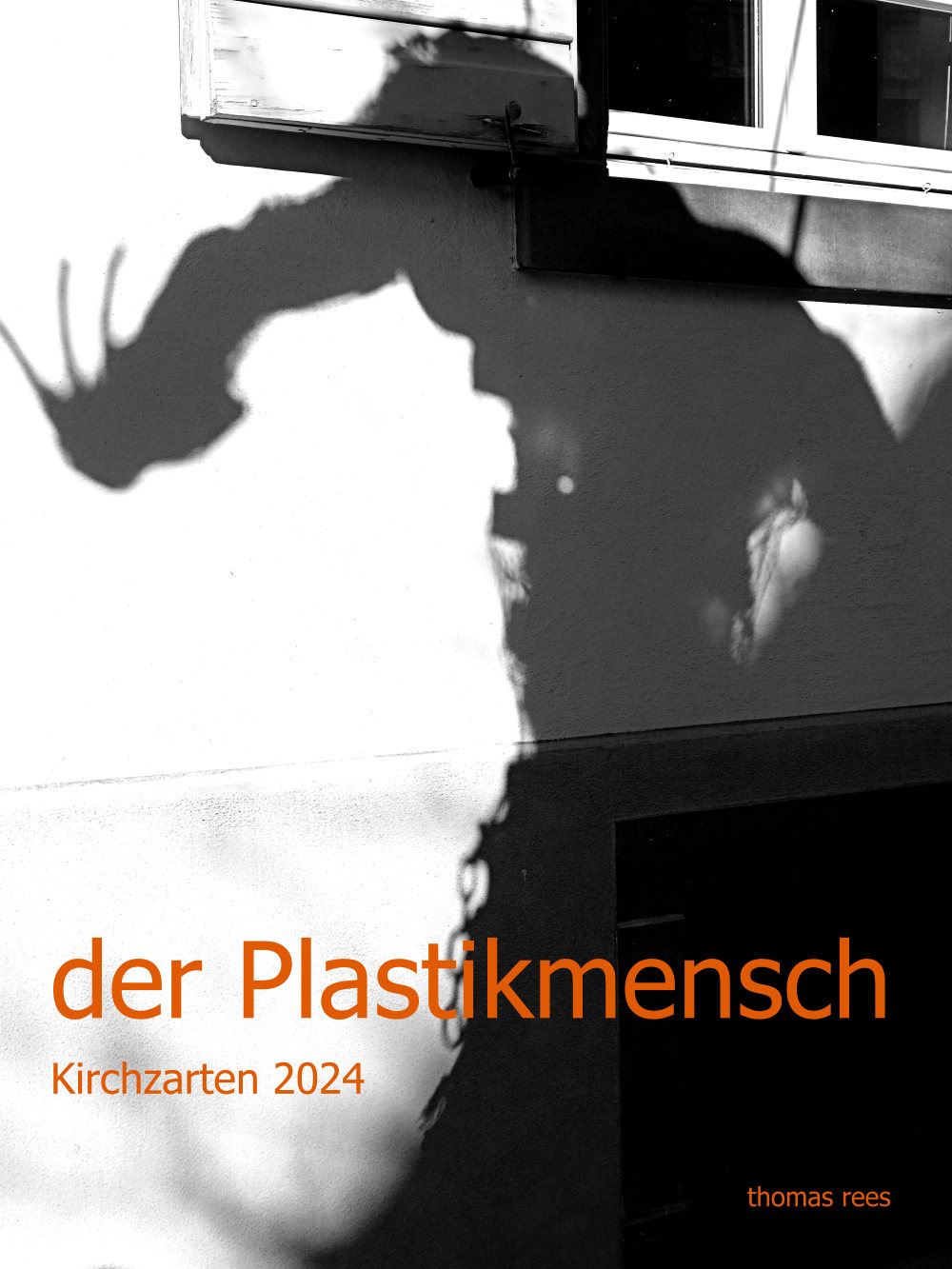Klangbeiträge im Rahmen der Themenwege
- Soundscape Pfarrkirche
- Soundscape Kulturlandschaft
- Soundscape Transportseilbahn
- Soundscape Herchersattel
- Soundscape Wald Kamelberg
- Soundscape Baum der Erkenntnis
- Soundscape Dorfrand-Wiese-Wald
- Soundscape Herchersattel
- Soundscape Bach
- Soundscape Wimperfledermaus
- Soundscape Auerhuhn
- Soundscape Wald Prangenkopf
Soundscapes – Klanglandschaften
Die Klänge und Geräusche der Natur sind ein wahrer Informationsschatz für Ökologen. Sie verraten, wie artenreich ein Lebensraum ist und wie sich bestimmte Prozesse durch die Einwirkung des Menschen verändern. Der „Sound“ der Natur hat eine ökologische Funktion und diese gilt es zu erforschen.
Jeder, der mit offenen Ohren durch die Natur wandert, könnte mit geschlossenen Augen einen Wald von einer Wiese unterscheiden. Denn jeder Lebensraum hat seinen eigenen akustischen Fingerabdruck. Die uralte Kulturlandschaft des südlichen Schwarzwaldes mit ihren kleinräumigen Wechseln von Bergmischwäldern, extensiv genutzten Allmendweiden, Blockhalden, Seen und Mooren glazialen Ursprungs, Dörfern und kleinen Weilern bietet eine große Vielfalt an Klanglandschaften. Diese ergeben sich vor allem aus den Gesängen der Vögel, der Heuschrecken und Frösche. Aber auch das Rauschen des Windes, das Plätschern und Glucksen eines Baches oder das Geläut der Weidetiere ist Teil dieser akustischen Vielfalt. Die akustische Signatur einer Landschaft enthält also eine Vielzahl von Informationen über das jeweilige Ökosystem – nicht nur über das Vorkommen verschiedener Tierarten, sondern auch über seine strukturelle Zusammensetzung, den Grad der menschlichen Beeinflussung, jahres- und tageszeitliche Rhythmen sowie über klimatische Wechselbeziehungen.
Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen durch den Buchenwald fallen, die Buschwindröschen blühen und der weithin schallende Gesang des Buchfinks im Wald zu hören ist, heißt es: „Der Frühling ist da“. Der Sommer ist charakterisiert durch das Zirpen der Heuschrecken und Summen der Insekten. Der Herbst wird angezeigt durch die Rufe der Zugvögel, die Brunft der Hirsche, aber auch durch die zunehmende Stille und das Rauschen des Windes in den Baumkronen. Im Winter geben mancherorts die Rufe der Krähen, die in Scharen am späten Nachmittag von den Feldern zurück in ihre Koloniebäume fliegen, das akustische Signal für den Beginn des Abends.

Abbildungstext: Vögel singen zur Brutzeit, um ihre Reviere abzustecken und Weibchen anzulocken. Daher singen vor allem die Männchen. Man hört ihre Gesänge ab dem Spätwinter bis Ende Juli, wobei die Zeit von Ende April bis Anfang Juni den Höhepunkt markiert, an dem man besonders viele Arten gleichzeitig hören kann. Am intensivsten sind die Gesänge am Morgen. Dabei hat jede Vogelart einen anderen Zeitpunkt für den Gesangsbeginn, der durch die zunehmende Tageshelligkeit vorgegeben wird und jeden Tag in der gleichen Reihenfolge abläuft.
Natürlich haben die einzelnen Gesänge und Rufe der Tiere einen Selbstzweck. Individuen kommunizieren mit ihren Artengenossen zur Revierverteidigung oder um Weibchen anzulocken. Warnrufe lassen erkennen, ob ein Feind aus der Luft oder am Boden lauert. Solche akustischen Warnungen funktionieren teilweise sogar über Artgrenzen hinweg. Wenn Frösche im Frühjahr singen, um Weibchen anzulocken, schützt sie das gemeinsame Singen im Chor davor, als Individuum von Fraßfeinden ausfindig gemacht zu werden.
Wer gehört werden will, braucht seine eigene akustische Nische
Jedes Individuum und jede Art muss seine eigene akustische Nische finden, um sich Gehör zu verschaffen. Je mehr Arten in einem Habitat singen, je mehr Hintergrundgeräusche wie etwa das Rauschen eines Baches oder das Brummen einer stark befahrenen Straße vorhanden sind, umso kleiner ist der akustische Raum, der einem Individuum noch zur Verfügung steht, um seine Botschaft an den gewünschten Empfänger zu bringen. Im Laufe der Evolution haben sich die Arten eines Habitats akustisch aufeinander abgestimmt, indem sie entweder verschiedene Frequenzbereiche besetzen (also in unterschiedlichen Tonlagen singen) oder zu anderen Zeitpunkten singen. So verläuft der morgendliche Gesang der Vögel nach einem festgelegten zeitlichen Ablauf. Etwa achtzig Minuten vor Sonnenaufgang beginnt der Gartenrotschwanz mit seinem Gesang, während der Buchfink zu den Spätaufstehern gehört und als Letzter etwa zehn Minuten vor Sonnenaufgang in den Morgenchor der Vögel einfällt.
Dieses Prinzip wurde erstmals 1987 vom Bioakustiker Bernie Krause als „akustische Nischen–Hypothese“ formuliert. Diese Theorie besagt auch, dass das Verschwinden von Arten aus einem Gebiet eine hörbare und damit quantifizierbare Lücke in der jeweiligen Klanglandschaft hinterlässt. Änderungen in der Landnutzung, Zerstörungen von Lebensräumen, das Einwandern invasiver Arten oder der Klimawandel sind allesamt Gründe, warum zunehmend Arten verschwinden und Landschaften akustisch verarmen. Krause, eigentlich ausgebildeter Musiker und Komponist, kam auf diese Theorie, als ihm klar wurde, dass sich Spektrogramme von Naturaufnahmen wie die Partituren sinfonischer Musikstücke lesen lassen. Jede Art hat ihre eigene Stimme im Orchester der Natur.
Abbildungstext: Die Partitur der Natur. Jede Tierart hat ihre eigene Stimme im Orchester der Natur. Hintergrundgeräusche wie Verkehr oder Windrauschen beengen den akustischen Raum und geben den Klangteppich vor, in dem die „Solisten“, die einzelnen Stimmen ihre Wirkung entfalten können.
Als Konsequenz aus der akustischen Nischen-Hypothese ergibt sich, dass Störungen im Ökosystem akustische Lücken hinterlassen. Im Kappler Tal ist die Feldgrille noch weithin hörbar. Gefährdet ist sie sowohl durch die Intensivierung der Landwirtschaft beispielsweise durch häufigeres Mähen und Düngen als auch durch die Nutzungsaufgabe von extensiv genutzten Wiesen und Weiden. Verschwindet die Feldgrille, ließe sich dies mit akustischen Methoden schnell und kostengünstig nachweisen. Auch Veränderungen im jahreszeitlichen Ablauf der Gesänge zum Beispiel durch den Klimawandel lassen sich akustisch leicht dokumentieren.
Soundscape – Ökologie: die Erforschung der ökologischen Bedeutung der Klänge in der Natur
Zwischen Mensch und der Natur und damit auch der Klanglandschaft an einem Ort gibt es verschiedene Wechselwirkungen: Lärm von Autoverkehr, Flugzeugen, Landmaschinen, aber auch Kirchenglocken oder das Spiel von Kindern auf dem Fußballplatz sind akustische Komponenten, die der Mensch direkt zur Klanglandschaft beiträgt. Zugleich beeinflusst der Mensch durch Landnutzung die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften vor Ort, also auch der vokalisierenden Tierarten. Darüber hinaus wirken sich Veränderungen in den Strukturelementen einer Landschaft – Flurbereinigung, Begradigung von Bächen, Eingriffe in die Komplexität der Vegetationsstruktur, Flächenversiegelung – auch auf die Geräusche der abiotischen Natur aus, insbesondere den Klang des Windes, des Regens und der Gewässer.
Für die Ästhetik und den Erholungswert einer Landschaft ist die Akustik genauso wichtig wie ein unverfälschtes Landschaftsbild und die für den Schwarzwald typischen Wechsel von Wäldern und Weiden. Akustische Signaturen sind damit auch identitätsstiftende Elemente der Landschaft und ein bedeutendes Element in der Beziehung zwischen Mensch und Natur.
Das Kappler Tal:
vielfältige Klangaspekte in einer grünlandreichen Kulturlandschaft
Das Kappler Tal weist eine reiche akustische Landschaft auf. Wie für eine kleinbäuerliche Kulturlandschaft typisch, finden wir hier Klanglandschaften extensiver Weiden, verschiedener Waldtypen und des dörflichen sowie land- und forstwirtschaftlichen Wirkens. Diese Elemente wechseln kleinräumig und sind entlang des Wanderpfades erlebbar. An verschiedenen Punkten werden in der App Besonderheiten der hiesigen akustischen Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten vorgestellt: Am Waldrand oberhalb des Sportplatzes (Übergang von Dorfrand, Wald und Wiese) vermischen sich die verschiedenen Strukturen klanglich miteinander, wir hören Tierarten der Wiesenlandschaften, aber auch typische Bewohner des Waldes und die Geräusche aus dem Dorf. Am Baum der Erkenntnis prägt das Verkehrsrauschen der B31 das Klangbild. Informationen zum Einfluss von menschlichem Lärm auf die Tierwelt finden sich im dazugehörigen Text auf der App. Von den Wiesen am Pfeiferberg und Herchersattel erschallt besonders im Sommer ein vielfältiges Insektenkonzert. Hier verweist die App auf die Besonderheiten einer grünlandreichen Kulturlandschaft und wie diese eine Landschaft akustisch prägt. Historisch hat der Bergbau das Kappler Tal auch klanglich sehr geprägt. Das Wegfallen der ratternden Transportseilbahn markiert das Ende der Bergbauzeit in den Kappler Soundscapes nachhaltig.
Abbildungstext: Die Soundscape-Ökologie untersucht die Verteilung unterschiedlicher Klangkomponenten in der Landschaft und deren Interaktion. Dies dient der Erforschung der ökologischen Bedeutung von Klängen und Geräuschen in einem Ökosystem.
Sie können die Klangbeispiele über die App einfach von ihrem Handy abspielen. Wir empfehlen aber das Hören mit Kopfhörern. An jedem Punkt finden sich mehrere Klangbeispiele. Gerne können sie die Beispiele aber auch zu Hause nachhören und auf unserer Webseite weitere akustische Highlights entdecken.
1Krause, B.L., 1987. Bio-Acoustics: Habitat Ambience & Ecological Balance.
Whole Earth Rev, (57), pp.14–18.
Soundscapes für das Projekt Mensch-Zeit-Erde, Themenweg Lebensraum Freiburg-Kappel Konzept und Inhalt : Dr. Sandra Müller unterstützt durch: Prof. Dr. Michael Scherer-Lorenzen, Kappler Bürger Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Fakultät für Biologie, Institut für Biologie II
die App dazu:
BIOS Kappler Tal